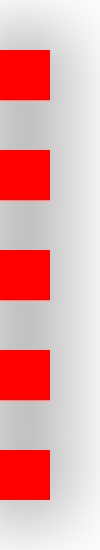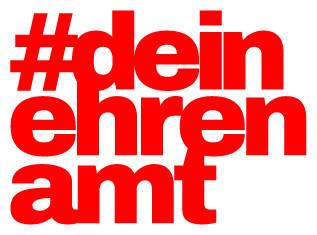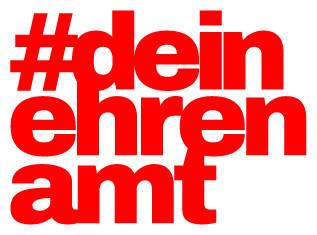Du arbeitest aktiv in einem Verein und fragst dich, was es mit der E-Rechnung auf sich hat oder was die neuesten Regelungen zur Mitgliederversammlung sind? Du möchtest dich über die steuerlichen Vorteile informieren? Du suchst Antworten darauf, was eigentlich ein Lobby-, Transparenz- oder Zuwendungsempfängerregister ist und was das für deinen Verein bedeutet? Oder du bist gerade dabei einen Verein zu gründen und brauchst Durchblick im Vereinsrecht?
Hier findest du Antworten auf wichtige Fragen rund um die ehrenamtliche Mitwirkung im Verein – und viele praktische Tipps und Hilfen.
Seit dem 28. Juni 2025 ist das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft.
Du bist in einem Verein, einer Stiftung oder einer gGmbH aktiv und fragst dich, was dieses Gesetz für deine Organisation bedeutet? Hier findest du einen Überblick.
Selbst wenn im Einzelfall keine rechtliche Verpflichtung besteht, lohnt es sich, Barrierefreiheit aktiv anzugehen. Ein barrierefreier Zugang zu Informationen, Veranstaltungen und Angeboten ist ein Gewinn – für die Mitglieder, für die Gesellschaft und für die Zukunftsfähigkeit des Vereins.
Was ist das BFSG?
Das BFSG verpflichtet Unternehmen und Organisationen, ihre Produkte und Dienstleistungen im Internet barrierefrei anzubieten.
Ziel des Gesetzes ist es, dass Menschen mit Behinderungen ohne besondere Hürden an digitalen Angeboten teilhaben können. Dazu gehören zum Beispiel klar strukturierte Inhalte, Untertitel für Videos, alternative Texte für Bilder sowie die Unterstützung von Screenreadern.
Wer ist vom neuen BFSG betroffen?
Ob das BFSG für euch als gemeinnützige Organisationen gilt, hängt vom Einzelfall ab, da gemeinnützige Organisationen nicht per se vom Anwendungsbereich ausgeschlossen sind.
Maßgeblich ist, ob ihr wirtschaftlich tätig seid – also ob ihr kostenpflichtige digitale Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die sich an Verbraucherinnen und Verbraucher richten.
Betroffen seid ihr zum Beispiel dann, wenn ihr über eure Website Tickets, Kurse, Merchandise oder andere bezahlte Angebote bereitstellt.
Nicht betroffen seid ihr hingegen, wenn eure Internetseite nur Informationen bereitstellt oder die Webseite zur Beantragung einer Mitgliedschaft nutzt.
In solchen Fällen handelt es sich nicht um ein Angebot an Verbraucher im Sinne des Gesetzes.
Ausnahme für Kleinstunternehmen
Für viele von euch wichtig ist die Ausnahmeregelung für Kleinstunternehmen. Gemeinnützige Organisationen – also Vereine, Stiftungen oder gGmbHs – sind vom BFSG befreit, wenn sie als Kleinstunternehmen gelten. Das ist der Fall, wenn ihr weniger als zehn Beschäftigte habt und euer Jahresumsatz höchstens zwei Millionen Euro beträgt. Vollzeit- und Teilzeitkräfte werden dabei anteilig gezählt, ehrenamtlich Mitarbeitende jedoch nicht.
Diese Grenze ergibt sich aus dem europäischen Recht, das Kleinstunternehmen europaweit einheitlich definiert und damit kleinere Organisationen vor zu hohen bürokratischen Anforderungen schützen soll.
Was heißt „konform mit dem BFSG“?
Das BFSG schreibt keine einzelnen technischen Details vor, sondern legt nur Ergebnisse in Bezug auf die Barrierefreiheit fest.
Im Moment gilt als besonders wichtig, dass Informationen über mindestens zwei Sinneskanäle zugänglich gemacht werden. Für Videos und Bilder würde dies zum Beispiel bedeuten, dass diese mit Untertiteln ausgestattet werden sollten. Ebenso ist die Erstellung einer Erklärung zur Barrierefreiheit auf der Webseite erforderlich.
Tipps zu konkreten Maßnahmen, die ihr ergreifen könnt, um die geforderte Barrierefreiheit zu erreichen
Wenn ihr vom BFSG betroffen seid, sind dies die wichtigsten Anforderungen und Maßnahmen:
- Digitale Barrierefreiheit sicherstellen
- Unterstützung von Screenreadern, also semantisch korrekter HTML-Aufbau
- Texte über mehr als einen Sinneskanal, also z. B. Untertitel für Videos, alternative Texte für Bilder
- Verwendung barrierefreier oder farbenblindfreundlicher Farbkonzepte
- Gute Farbkontraste, klare Schriftarten, ausreichende Abstände
- Nutzung verständlicher und einfacher Sprache, ggf. mit Erklärungen zu Fachbegriffen
- Downloadinhalte wie PDFs sollten ebenfalls barrierefrei gestaltet sein
- Barrierefreiheitserklärung
Es ist erforderlich, eine Erklärung zur Barrierefreiheit bereitzustellen, in der dokumentiert wird, wie barrierefrei das Angebot ist und wo ggf. noch Mängel bestehen.
Bis wann muss das BFSG umgesetzt werden?
Das BFSG gilt seit dem 28. Juni 2025 und muss auch seit dem beachtet werden. Neue Inhalte auf euer Webseite müssen also ab jetzt gleich auch barrierefrei erstellt werden. Es gibt aber eine Übergangsfrist für bereits bestehende digitale Dienstleistungen und Produkte, diese müssen bis zum 27. Juni 2030 angepasst werden.
Für spezielle Geräte, die bereits vor dem 28. Juni 2025 in Betrieb genommen wurden, wie zum Beispiel Selbstbedienungsterminals, gelten in manchen Fällen verlängerte Übergangsfristen bis zum 28. Juni 2040. Ob das bei euch zutrifft, solltet ihr am besten mit einem Experten/ Expertin für Barrierefreiheit klären.
Vorteile und Chancen einer barrierefreien Webseite
Durch ein inklusives Angebot und einen barrierefreien Webauftritt wird die Erreichbarkeit einer Webseite erhöht.
Die größere Teilhabemöglichkeit erlaubt es, eine wesentlich größere Zielgruppe zu erreichen. Zudem haben barrierefreie Webangebote einen positiven Effekt bei der Suchmaschinenoptimierung. Somit könnt ihr im Internet viel besser gefunden und eure Webseite häufiger besucht werden.
Zunehmend wichtiger wird auch der finanzielle Aspekt: Immer mehr öffentliche Förderprogramme, Zuschüsse und Projektmittel sind an ein überzeugendes Barrierefreiheitskonzept geknüpft. Wer Barrierefreiheit von Beginn an mitdenkt, verbessert daher nicht nur die eigene digitale Präsenz, sondern schafft auch die Voraussetzungen, um künftig von Förderungen profitieren zu können. Das kann insbesondere für gemeinnützige Organisationen entscheidend sein, um Projekte erfolgreich zu planen und umzusetzen.
Kurz gesagt:
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz soll dafür sorgen, dass das Internet für alle Menschen besser nutzbar wird, ganz unabhängig von möglichen Einschränkungen. Für alle, die eine Internetseite betreiben, wird Inklusion damit zu einem wichtigen Aspekt bei der Gestaltung und Überarbeitung ihrer Online-Angebote.
Barrierefreiheit lohnt sich in jeder Hinsicht – auch wenn ihr vielleicht keine rechtliche Pflicht dazu habt. Sie verbessert die Nutzbarkeit, erhöht die Reichweite und trägt zu einer modernen und offenen Kommunikationskultur bei.
Linksammlung für Interessierte:
Ab dem 01.01.2025 wird die E-Rechnung verpflichtend. Jeder Verein muss dann in der Lage sein, die E-Rechnungen einzulesen, zu prüfen und zu archivieren.
Auf den Seiten der DSEE (Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt) findet ihr alles Wissenswerte sowie die wichtigsten Fragen und Antworten.
Darüber hinaus könnt ihr euch auch auf der Homepage des Bundesfinanzministeriums zur E-Rechnung informieren. Folgende FAQ´s beantworten die dringlichsten Fragen zu dem Thema:
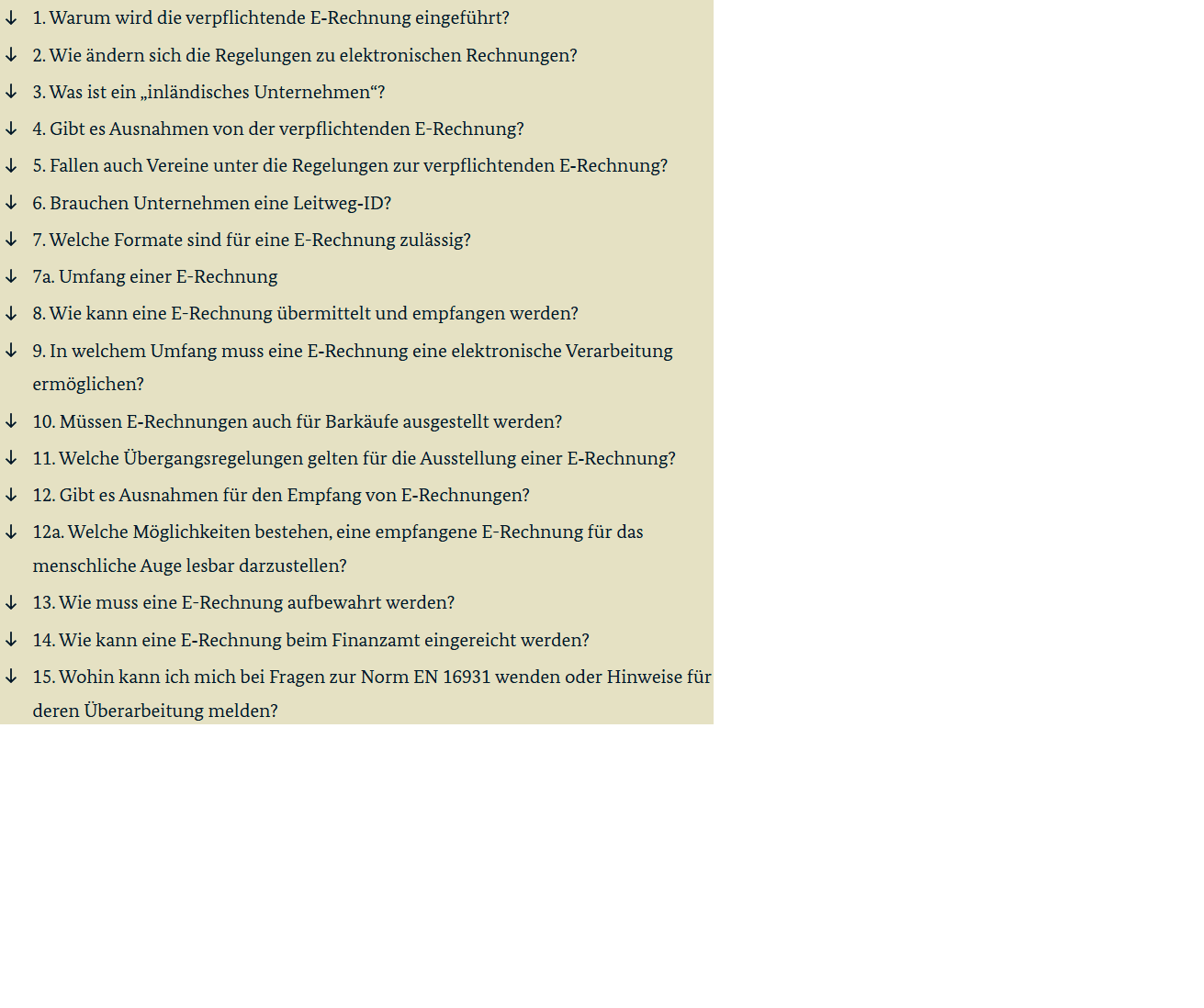
Grundsätzliches:
Jeder, der ein Fernseh- und/ oder Radioempfangsgerät besitzt, muss Gebühren an die sogenannte Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (kurz GEZ) zahlen. Es müssen auch internetfähige Computer angemeldet werden, sofern man mit ihnen Rundfunk- und Fernsehbeiträge empfangen kann. Auch bei gemeinnützigen Organisationen, wie Vereinen wird ein Rundfunkbeitrag fällig.
Grundsätzlich wird die Rundfunkgebühr nicht mehr nach Anzahl der Geräte, also Fernsehern, Radios etc., abgerechnet, sondern nach Betriebsstätten.
Was ist eine Betriebsstätte?
Eine Betriebsstätte ist jeder Ort, an dem euer Verein aktiv ist. Das kann ein Vereinsheim, eine Vereinsgaststätte oder auch nur ein gemieteter Raum sein. Das bedeutet z. B., dass ein Sportverein, der ein Vereinshaus am Sportplatz betreibt, für dieses die Rundfunkgebühr bezahlen muss. Dabei spielt es keine Rolle, ob dort tatsächlich ein Fernseher oder ein anderes Rundfunkgerät steht. Bei Vereinen, die ihre Betriebsstätten in privaten Wohnungen haben, wenn zum Beispiel die Versammlungen im Haus des Vorsitzenden stattfinden, der bereits privat einen Rundfunkbeitrag entrichtet, muss der Verein keinen zusätzlichen Rundfunkbeitrag bezahlen.
Wann müssen Vereine, Stiftungen und Einrichtungen keine Beiträge zahlen:
Vereine, Stiftungen und gemeinnützige Einrichtungen müssen keinen Rundfunkbeitrag zahlen, wenn in einer Betriebsstätte nur ehrenamtliche Mitarbeiter oder Mitarbeitende auf 1-Euro-Basis tätig sind. Auch Funktionsräume wie Sporthallen oder Trainingsgelände stellen keinen „eingerichteten Arbeitsplatz“ dar und sind beitragsfrei. Dies gilt auch für Lagerflächen und Räume, in denen Gottesdienste abgehalten werden. Für andere Betriebsstätten, wie Vereinsheime und Vereinsgaststätten, müssen jedoch Beiträge entrichtet werden, es sei denn, die Gaststätte ist nicht öffentlich zugänglich und wird nur von Vereinsmitgliedern genutzt.
Sonderregelungen für Kraftfahrzeuge
Sind auf den Verein Kraftfahrzeuge (Kfz) zugelassen, sind diese grundsätzlich beitragspflichtig. Allerdings gilt auch hier eine Ausnahme für eingetragene gemeinnützige Vereine. Alle auf die Einrichtung oder deren Rechtsträger zugelassenen Kraftfahrzeuge sind beitragsfrei, sofern diese ausschließlich zu Zwecken der Einrichtung genutzt werden.
Was ist zu tun, wenn wir vom Beitragsservice angeschrieben werden?
Seid ihr ein eingetragener gemeinnütziger Verein und erhaltet ein Schreiben vom Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio zur Klärung der Beitragspflicht, solltet ihr darauf reagieren. Am schnellsten geht dies über das Online-Formular mit der Postleitzahl und dem Aktenzeichen aus dem Schreiben. Alternativ kann der beigefügte Antwortbogen ausgefüllt und per Post zurückgeschickt werden.
Beschäftigt euer Verein ausschließlich Ehrenamtliche und besitzt keine beitragspflichtigen Kraftfahrzeuge? Dann gebt entweder im Antwortbogen oder im Online-Formular an, dass kein eingerichteter Arbeitsplatz vorhanden ist.
Alle Informationen rund um die Rundfunkgebühren findet ihr hier: https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e5289/Merkblatt_Unternehmen_Institutionen_und_Einrichtungen_des_Gemeinwohls.pdf
Vereine schenken Lebensqualität!
Ob Sport oder Musik, Kultur, karitative Zwecke, Hobby, Umweltschutz und vieles mehr: Vereine bereichern das gesellschaftliche Leben und sind wichtige Orte der Begegnung und des Miteinanders. Viele Menschen üben in ihrem Verein eine ehrenamtliche Tätigkeit aus und gestalten das Vereinsleben und soziale Miteinander in der Gesellschaft aktiv mit. Wer dies tut, sollte jedoch die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Arbeit in Vereinen kennen. Und auch wer einen Verein gründen möchte, braucht hierfür das nötige Rüstzeug.
Ich engagiere mich aktiv im Verein, worauf muss ich achten?
Jeder Verein ist einzigartig, aber es gibt bestimmte Empfehlungen, Richtlinien, gesetzliche Bestimmungen und Hinweise zum Engagement im Verein. Viele wichtige Informationen dazu vermittelt die Broschüre zum Vereinsrecht, die das Hessische Justizministerium herausgegeben hat. Die Broschüre ersetzt zwar im Fall der Fälle keine anwaltliche Beratung und kann auch die Gesetzeslage nicht in vollem Umfang darstellen. Aber sie ist ein guter Einstieg in die Materie und informiert über die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches, die das private Vereinsrecht regeln.
Für wen ist die Broschüre interessant?
Die Broschüre zum Vereinsrecht ist ein Leitfaden für all diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, einen Verein zu gründen, ihm beizutreten oder Vereinsämter zu übernehmen. Denn in diesem Fall ist es wichtig, sich über die Rechte und Pflichten von Vereins- und Vorstandsmitgliedern und die wichtigsten Vorschriften für eingetragene Vereine zu informieren. Regelungen des Steuerrechts, des Parteiengesetzes und des öffentlichen Vereinsrechts werden in der Broschüre jedoch nicht behandelt.
Seit dem 21. März 2023 dürfen Vereine, auch ohne vorher die Satzung zu ändern, Mitgliederversammlungen rein digital oder in hybrider Form durchführen. Was im Rahmen einer Corona-Sonderregelung bis Sommer 2022 möglich war, wurde nun durch eine Änderung des Vereinsrechts (§ 32 BGB) dauerhaft normiert. Mitgliederversammlungen in Präsenz sind selbstverständlich weiterhin möglich.
Hybrid oder in Präsenz: der Vorstand entscheidet
Nach der neuen Regelung kann der Vorstand, der die Mitgliederversammlung einberuft, festlegen, ob die Mitgliederversammlung als hybride Veranstaltung oder wie bisher als Präsenzveranstaltung durchgeführt wird. Bei einer hybriden Veranstaltung können die Teilnehmenden wählen, ob sie digital dabei sind oder in Präsenz vor Ort. Bei hybriden Versammlungen muss der Vorstand zudem entscheiden, „wie die Mitglieder ihre Rechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können“, also beispielsweise mit welchem Videokonferenz-Tool.
Digital: nur mit Beschluss der Mitgliederversammlung
Die rein virtuelle Durchführung einer Mitgliederversammlung darf nur die Mitgliederversammlung selbst beschließen. Den Anstoß dazu kann der Vorstand oder können Mitglieder des Vereins geben. Ein Anspruch auf die digitale Teilnahme an der Mitgliederversammlung besteht dabei für die Mitglieder nicht. Vereine können diese Art der Durchführung anbieten, müssen es aber nicht. Gleiches gilt für briefliche Abstimmungen.
Es empfiehlt sich in der nächsten turnusmäßigen Mitgliederversammlung darüber zu entscheiden, ob die Versammlungen künftig in Präsenz, digital oder hybrid stattfinden soll. Der entsprechende Beschluss ist dann für die Zukunft bindend, bis ein neuer Beschluss getroffen wird. Für den Beschluss, in welcher Form die Mitgliederversammlungen stattfinden sollen, reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sollte in der Satzung bereits die Möglichkeit von digitalen Mitgliederversammlungen vorgesehen sein, braucht es keinen weiteren Beschluss der Mitgliederversammlung im Vorfeld.
Digital oder hybrid: Festlegung des Tools durch den Vorstand
Soll die Mitgliederversammlung in virtueller oder hybrider Form durchgeführt werden, muss der Vorstand in der Ladung zur Mitgliederversammlung angeben, auf welchem Wege die virtuell anwesenden Mitglieder am Willensbildungsprozess der Mitgliederversammlung teilnehmen können – also sich bei Diskussionen zu Wort zu melden, Anträge zu stellen und an Abstimmungen teilzunehmen. Hierbei stehen alle Wege moderner Kommunikation zur Verfügung. Es ist also möglich, die Mitgliederversammlung als Video- oder Telefonkonferenz abzuhalten und sogar nur über Chat-Dienste zu kommunizieren.
Aus der Neuregelung geht allerdings nicht hervor, dass alle diese Möglichkeiten gegeben sein bzw. angeboten werden müssen. Zu beachten ist, dass Einzelprobleme noch nicht gelöst sind. Wichtig ist, dass sichergestellt ist, dass die Mitglieder ihre Rechte auch in einer rein virtuellen Mitgliederversammlung vollumfassend ausüben können.
Hilfe bei der Frage, welches Tool den Schutz personenbezogener Daten gewährleistet findet ihr bei unserem digitalen Werkzeugkasten.
Schriftliche Abstimmung
Für die Beschlussfassung in einem schriftlichen Verfahren bedarf es die Zustimmung aller Mitglieder. Durch diese Einschränkung wird eine schriftliche Abstimmung wohl nur für Vereine mit sehr wenigen Mitgliedern infrage kommen. Wollt ihr das ändern, so müsst ihr die Satzung an dem Punkt entsprechend ergänzen.
Neue Regelung gilt auch für Vorstandssitzungen
Die Änderungen des Vereinsrechts betreffen neben der Mitgliederversammlung auch die Sitzungen des Vorstands, wenn dieser aus mehreren Personen besteht. Dieser kann nun ohne weitere Voraussetzungen Sitzungen hybrid durchführen. Auf Beschluss des Vorstands können zudem Vorstandssitzungen künftig auch als virtuelle Sitzungen stattfinden.
Stiftungsvorstände können ebenso nach dieser Regelung verfahren. Ausnahme: Die Satzung der Stiftung sieht etwas Anderes vor.
weitere Informationen:
- geeignete technische Werkzeuge zur Durchführung virtueller und hybrider Vereinssitzungen finden sich in unserem Digi-Café oder direkt im Digitalen Werkzeugkasten
- Pressemitteilung des Bundesministeriums der Justiz
Steuern und Ehrenamt – mehr Durchblick mit dem Steuerwegweiser
Gemeinnützige Vereine genießen aufgrund ihres besonderen Beitrags für das Gemeinwohl Steuerbefreiungen oder erhalten Steuerermäßigungen. Das Land Hessen hat dafür den Steuerwegweiser für gemeinnützige Vereine und für Übungsleiterinnen und Übungsleiter herausgegeben, der 2022 aktualisiert wurde. Der Steuerwegweiser enthält Beispiele, praktische Tipps und Erläuterungen. Auf der Webseite des Finanzministeriums gibt es viele Informationen zum Thema: Steuerhinweise für Ehrenämter und Vereine. Darüber hinaus hilft euch auch gerne euer zuständiges Finanzamt bei Fragen weiter.
Abgabe einer Steuererklärung
Bei der Steuererklärung müssen Vereine eine Reihe von Unterlagen beifügen, um in den Genuss von Ermäßigungen zu kommen. Hier findest du die wichtigsten Formulare für Geldzuwendungen und Sachzuwendungen zum Download.
Steuertipps für deine ehrenamtliche Tätigkeit...
findest du übrigens auf der Themenseite Wissenswertes rund um dein Ehrenamt.
Die Grundsteuerreform betrifft auch Vereine, Stiftungen und andere Non-Profit-Organisationen, selbst wenn sie mit ihrem Grundbesitz grundsteuerbefreit sind.
Unabhängig davon, ob eine Grundsteuerbefreiung greift, sind gemeinnützige Körperschaften in Hessen, die zum Stichtag 01.01.2022 als Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte gelten, in der Regel bis zum 31.10.2022 zur Abgabe einer Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwertes auf den 01.01.2022 verpflichtet.
Wichtig
Die Erklärung zum Grundsteuermessbetrag ist elektronisch abzugeben. Dazu kann ganz einfach das ELSTER-Portal genutzt werden, ein sicherer und kostenloser Service der Steuerverwaltungen in Deutschland. Es ist nur eine überschaubare Anzahl an Angaben zu machen.
Vorteil
Die elektronische Abgabe erleichtert das Ausfüllen der Erklärung und beugt Übertragungsfehlern vor.
Hilfe gibts unter: www.grundsteuer.hessen.de
Viele Informationen finden sich unter www.grundsteuer.hessen.de, so auch Klickanleitungen, die einen durch die Abgabe der Erklärung mit ELSTER Schritt-für-Schritt führen. Hilfreich ist auch die Anleitung und der Link zu dem Flurstücksnachweis. Sollten nicht alle Daten, die für die Erklärungsabgabe benötigt werden, vorliegen, hilft zumeist dieser Flurstücksnachweis, ohne dass man sich an das Grundbuchamt oder an die Ämter für Bodenmanagement (Katasterbehörden) wenden muss.
Wichtige Vereinfachung für steuerbefreite Grundstücke
Die Ermittlung der Gebäudeflächen kann durch Schätzung (z.B. überschlägige Ermittlung der Wohn- und / oder Nutzungsflächen) erfolgen, wenn die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung weiterhin bestehen.
Näheres findet sich in der Rundverfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt vom 29.06.2022, unter: https://finanzamt.hessen.de/grundsteuerreform/grundsteuer-b-in-hessen.
Wichtig für alle Vereine
Wer bislang keine Grundsteuer entrichten muss, kann davon ausgehen, dass das so bleibt. Zwar gilt auch für steuerbefreite Grundstücke die Pflicht zur Abgabe der Erklärung. Dies berührt aber nicht den Sachverhalt der Steuerbefreiung.
Übrigens: Gerne kannst du deine Mitstreiter im Verein oder Stiftung auf die Abgabepflicht für ihre privaten Grundstücke hinweisen. Erledigt ist erledigt.
Im September 2022 erhielten viele einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige zum Ausgleich der hohen Energiekosten eine Pauschale von einmalig 300 Euro brutto. Die Pauschale ist Teil des Steuerentlastungsgesetzes, in dem der Gesetzgeber mehrere Entlastungsmaßnahmen beschlossen hat.
Berechtigt können aber auch Ehrenamtliche sein, sofern sie ausschließlich steuerfreien Arbeitslohn beziehen. Das bedeutet, dass auch die Ehrenamtlichen einen Anspruch haben, die eine Aufwandsentschädigung oder Ehrenamtspauschale erhalten. Details, was du als Ehrenamtlicher über die Pauschale wissen solltest, findest du unter: https://www.deinehrenamt.de/Wissenswertes
Da viele steuerbegünstigte Vereine oder gGmbHs sich die Auszahlung der Pauschale an jeden einzelnen ehrenamtlich Tätigen nicht leisten können, wird empfohlen, dass die Empfänger von ehrenamtlichen Pauschalen die Energiepreispauschale im Rahmen der Einkommenssteuererklärung zum Kalenderjahr 2022 beantragen.
Das Bundesfinanzministerium hat einen Frage-Antwort-Katalog rund um das Thema Energiepreispauschale zusammengestellt:
Bundesfinanzministerium - FAQ „Energiepreispauschale (EPP)“
In allen weiteren Fällen hilft das örtlich zuständige Finanzamt bei Fragen gerne weiter.
Was ist eine Spende?
Spenden sind freiwillige Geld- oder Sachleistungen zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden und die kein Entgelt für eine Gegenleistung darstellen.
Die Möglichkeiten einer Spende...
- Geldspende in Form von:
- Barzahlung oder Überweisung
- Verzicht auf Zahlung einer Lieferung oder Leistung für den Verein
- Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen für den Verein (sog. Aufwandsspende)
- ggfs. auch Mitgliedsbeitrag
2. Aufwandsspende:
- Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen für den Verein
- Verzicht auf Auszahlung der Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschale
- Verzicht auf Auszahlung der Tätigkeitsvergütung für Vorstandsmitglieder
- notwendig: Erstattungsanspruch!
- näheres regelt BMF-Schreiben vom 25.11.2014, BStBl I 2014, 1584
3. Sachspenden
Das Hessische Ministerium der Finanzen bietet ebenfalls Informationsmaterial auf seiner Webseite an.
Wissenswertes und Näheres zum Thema Spenden gibts direkt hier: Gemeinnützige Vereine und Steuern - Wissenswertes_Nov_2023.pdf (hessen.de)
Muster für die Zuwendungsbestätigung
Die Zuwendungsbestätigung muss durch den Verein oder die Stiftung nach einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck ausgestellt werden. Nur damit kann der Spendende eine steuerliche Begünstigung beantragen. Muster für die Zuwendungsbestätigungen findest du hier: Geld- und Sachzuwendungen.
Was ist das Zuwendungsempfängerregister überhaupt?
Das Zuwendungsempfängerregister ist seit dem 1.1.2024 in Kraft und wird beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) geführt. Es umfasst alle Organisationen, die berechtigt sind, Zuwendungsbestätigungen (umgangssprachlich: Spendenbescheinigungen) auszustellen. Dies sind alle steuerbegünstigten Körperschaften i.S.d. §§ 51-68 AO – also solche, die gemeinnützige, mildtätige und/oder kirchliche Zwecke verfolgen. Es umfasst aber auch die anerkannten politischen Parteien und unabhängigen Wählervereinigungen (vgl. § 34g EStG).
Zweck des Registers ist es insbesondere, Spendern und sonstigen Zuwendungsgebern einen schnellen und unbürokratischen Überblick zu ermöglichen, ob die von ihnen bedachte Organisation tatsächlich von der Finanzbehörde als steuerbegünstigt anerkannt und zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen berechtigt ist. Hierdurch sollen Täuschungen und Missbräuche erschwert und die Transparenz des „Dritten Sektors“ erhöht werden.
Zugleich erleichtert das Register den Einstieg in den elektronischen Spendenabzug – und die überfällige Abkehr von Spendenbescheinigungen in Papierform.
Muss ich als Verein oder Stiftung jetzt tätig werden?
Nein, denn für das neue Register übermitteln die für die Körperschaften zuständigen Finanzämter dem BZSt die benötigten Daten. Es empfiehlt sich jedoch, die Aktualität der eigenen Daten beim Finanzamt auf Richtigkeit zu überprüfen.
Die folgenden Daten werden künftig - unter Aufhebung des Steuergeheimnisses - (§ 60b Abs. 2 AO n.F.) einsehbar:
- Wirtschafts-Identifikationsnummer
- Name, Anschrift, Bankverbindung
- steuerbegünstigte Zwecke
- zuständiges Finanzamt
- Datum des letzten die Steuerbegünstigung bestätigenden Bescheides (Körperschaftsteuerbescheid, Freistellungsbescheid oder Feststellungsbescheid nach § 60a AO)
Auch Änderungen müssen von den Finanzbehörden dem BZSt mitgeteilt werden. Zusätzlich erfolgt durch das BZSt ein Abgleich mit den Verfassungsschutzberichten des Bundes und der Länder.
Das neue Register bietet auch ausländischen Körperschaften erleichterte Möglichkeiten, steuerbegünstigte Spenden aus Deutschland zu erhalten: Sie können sich beim BZSt für steuerliche Zwecke registrieren und den Nachweis führen, dass sie die deutschen Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit erfüllen.
Aufgrund seiner Aktualität begründet das geplante Register auch für gemeinnützige Zuwendungsgeber (z.B. Fördervereine und -stiftungen) einen zusätzlichen Vertrauensschutz.
Was ist das Lobbyregister überhaupt?
Das Lobbyregistergesetz (LobbyRG) ist seit dem 1.1.2022 in Kraft und zeigt mit der Registrierung von Interessenvertretern auf, dass Kontakte zu den Mitgliedern des Bundestags oder der Bundesregierung aufgenommen werden, um unmittelbar oder mittelbar Einfluss auf deren Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse zu nehmen, oder dies in Auftrag zu geben. Dadurch soll die Vertretung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Interessen gegenüber der Politik, die für ein demokratisches Gemeinwesen unabdingbar sind, transparenter werden.
Im Lobbyregister müssen sich Lobbyistinnen und Lobbyisten registrieren, im Gesetz wird dabei von Interessenvertretern gesprochen. Gemeint sind neben Einzelpersonen auch Non-Profits, die als “pressure groups” auftreten, außerdem kommerzielle Unternehmen wie PR-Agenturen.
Grundsätzlich umfasst Interessenvertretung zunächst einmal jede Form der Kontaktaufnahme, solange damit Einfluss ausgeübt werden soll.
Bezieht sich das Lobbyregister nur auf die Bundesebene?
In Bezug auf das Lobbyregister gemäß LobbyRG: ja. Allerdings hat der Hessische Landtag am 3. Juli 2023 das Gesetz über die Führung eines Lobbyregisters im Hessischen Landtag beschlossen, das am 12. Juli 2023 in Kraft getreten ist.
Wann betrifft das Lobbyregister uns?
Pflicht zur Eintragung ins Lobbyregister besteht, wenn: (§ 2 Abs. 1 LobbyRG bzw. § 1 Abs. 2 HessLobbyRG)
- Kontakte zur Interessenvertretung regelmäßig erfolgen,
- die Interessensvertretung auf Dauer angelegt ist,
- sie geschäftsmäßig für Andere betrieben wird oder
- es in den letzten drei Monaten mehr als 50 (künftig 30) unterschiedliche Kontakte dieser Art gab (dieses Merkmal besteht nur im LobbyRG des Bundes)
Ausnahmen?
Von der Eintragungspflicht ausgenommen sind: (§ 2 Abs. 2 LobbyRG bzw. § 3 HessLobbyRG)
- Eingaben von Privatleuten im persönlichen Interesse
- Anliegen von lokalem Interesse, wobei das Gesetz “lokal” so definiert, dass nicht mehr als zwei benachbarte Bundestagswahlkreise betroffen sein dürfen (z.B.: wenn die Arbeit sich rein um ein Naturschutzgebiet oder einen Kindergarten vor Ort dreht). Diese Ausnahme gilt nicht für Kontakte zu hessischen Abgeordneten oder Ministerialbeamten!
- Petitionen
- Teilnahme an öffentlichen Anhörungen und Veranstaltungen
- direkte Informationsbegehren
- Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften, Mandats- und Amtsträger, weltanschauliche und Religionsgemeinschaften sowie ausländische Personen oder Organisationen ohne Sitz in Deutschland.
- Dazu kommen weitere Ausnahmen, die in den o.g. Paragraphen aufgelistet werden.
Was ist neu?
Allgemeine Angaben:
- Eine Eintragungspflicht liegt künftig schon dann vor, wenn Kontakt zu den Mitarbeitenden des Deutschen Bundestags oder zu Referatsleitungen in Ministerien des Bundes zum Zwecke der Interessenvertretung aufgenommen wird (bislang ab Ebene der Unterabteilungsleitungen).
- Die Erheblichkeitsschwelle zur Registrierungspflicht wurde auf 30 Kontakte binnen drei Monate abgesenkt (bislang 50 Kontaktaufnahmen). Dadurch kann die Grenze künftig z.B. bei Rundschreiben an einen bestimmten Empfängerkreis schnell erreicht sein und eine Registrierungspflicht voraussetzen.
- Um den sog. Drehtüreffekt zu vermeiden, müssen Angaben für die letzten fünf Jahre zu früheren Tätigkeiten auf Bundesebene gemacht werden.
- Es müssen erweiterte Angaben aller Personen gemacht werden, die mit der Interessenvertretung nicht nur bei Gelegenheit betraut sind und diese unmittelbar ausüben. Daher müssen künftig auch ehrenamtlich tätige Vorstände oder Aufsichtsräte erfasst werden.
- Die Beschreibung der Tätigkeit der Interessenvertretung muss präzise geführt werden.
Angaben, die sich auf das Geschäftsjahr beziehen:
- Die Anzahl der Beschäftigten, die im Bereich der Interessenvertretung tätig sind, muss künftig nach Vollzeitäquivalenten aufgeführt sein (nicht mehr nach „Kopfzahl“)
- Die konkrete Bezeichnung eines Regelungsvorhabens, auf das sich die Interessenvertretung bezieht, muss angegeben werden ebenso wie grundlegende Stellungnahmen und Gutachten. Dies muss unter Angabe des Zeitpunkts, der betroffenen Interessen- und Vorhabenbereiche und einer abstrakten Adressatenbezeichnung erfolgen, so dass auch eine sachgerechte Zuordnung und Auswertung der zu erwartenden vielfältigen Informationen ermöglicht werden kann. Dies stellt eine der zentralen Neuerungen dar. Um „Doppelarbeiten“ zu vermeiden, sind nur solche Stellungnahmen oder Gutachten bereitzustellen, die nicht bereits innerhalb formalisierter Beteiligungsverfahren (§ 47 GGO und § 70 GO-BT) veröffentlicht werden.
- Die Hauptfinanzierungsquellen müssen nach bestimmten Kategorien in absteigender Reihenfolge geordnet angegeben werden.
- Neben einer Gesamtsumme müssen jährlich erhaltene Schenkungen und sonstige Zuwendungen Dritter sowie künftig auch Zuwendungen, die von einer Gegenleistung abhängen (wie z.B. Sponsoringleistungen) in Stufen von je 10.000 EURO angegeben werden.
- Die jährlichen finanziellen Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung müssen in Stufen von je 10.000 EURO angegeben werden.
- Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, Finanzangaben zu verweigern. Bei Schenkungen und sonstigen Zuwendungen Dritter sind die Schenker aber nur dann namentlich anzugeben, wenn diese den Gesamtwert von 10.000 Euro sowie zehn Prozent der Gesamtsumme der Schenkungen und sonstigen Zuwendungen im jeweiligen Geschäftsjahr übersteigen.
- Es muss ein Jahresabschluss oder Rechenschaftsbericht eingestellt werden.
- Erforderlich ist die Angabe der Gesamtsumme der Mitgliedsbeiträge in Stufen von 10.000 EURO und die Mitgliederzahl.
- Die namentliche Benennung eines Beitragszahlers ist erforderlich, wenn der einzelne Mitgliedsbeitrag den Gesamtwert von 10.000 EURO übersteigt und zugleich 10 Prozent der Gesamtsumme der Mitgliedbeiträge übersteigt.
- Die jährliche Aktualisierungspflicht korrespondiert mit dem jeweiligen Geschäftsjahr.
- Es besteht eine unverzügliche Aktualisierungspflicht für Pflichtangaben, wie z.B. Angaben zu Personen, die unmittelbar mit der Interessenvertretung betraut sind.
Handlungsbedarf:
Zwischen dem 1. März 2024 bis einschließlich 30. Juni 2024 müssen alle bestehenden Registereinträge entsprechend der neuen Gesetzeslage überarbeitet, ergänzt und zur Veröffentlichung im Lobbyregister freigegeben werden (sog. Migrationsprozess).
Das Gute ist, dass die Daten bestehender Registereinträge größtenteils übernommen und nur noch ergänzt und bestätigt werden müssen. Betroffene Organisationen finden ab sofort eine „To-do-Liste“, welche Änderungen und Ergänzungen sie vornehmen müssen. Darüber hinaus bietet die Bundestagsverwaltung Updates und Webinare zum Thema an.
>> Informationen und Hilfe - Lobbyregister beim Deutschen Bundestag
Zahlreiche Vereine haben Ende 2020 – manche aber auch erst im Jahr 2021 - erstmals Gebührenbescheide vom Bundesanzeiger Verlag erhalten. Viele Vereine sind unsicher im Umgang mit den Gebührenbescheiden zum Transparenzregister.
Zum Hintergrund:
Das im Geldwäschegesetz (GwG) §§ 18 ff verankerte Transparenzregister ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Register, in das seit dem 1. Oktober 2017 die wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften einzutragen sind. Der Zweck des Registers besteht darin, jenseits (verschachtelter) juristischer Strukturen die natürlichen Personen kenntlich zu machen, die am Ende dieser Strukturen stehen. Dies soll dazu beitragen, den Missbrauch von Vereinigungen und Rechtsgestaltungen zum Zweck der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern (Umsetzung der EU-Richtlinie 2015/849 vom 20. Mai 2015). Die in § 19 Abs. 1 GwG aufgeführten Angaben der wirtschaftlich Berechtigten sind von den Vereinigungen einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu halten und der registerführenden Stelle unverzüglich zur Eintragung mitzuteilen. Seit dem 1. August 2021 werden die bestehenden Daten automatisch vom Vereins- in das Transparenzregister übertragen. Vereine müssen in der Regel also keine Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten des Vereins machen. Etwas anderes gilt nur, wenn die Vorstände von Vereinen nicht in Deutschland wohnhaft sind oder nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Sollten diese beiden Annahmen nicht zutreffen, muss der Verein aktiv werden und die richtigen Angaben melden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Verein stets den neuen Vorstand dem Registergericht meldet.
Der Bundesanzeiger Verlag GmbH ist registerführende Stelle und mit dieser Aufgabe und den Befugnissen vom Bundesministerium der Finanzen gemäß § 25 Abs. 1 GwG, § 1 Transparenzregisterbeleihungsverordnung beliehen worden. Diese ist gemäß vom BMF erlassenen Transparenzregistergebührenverordnung berechtigt, von allen meldepflichtigen Vereinigungen für die Führung des Transparenzregisters eine Jahresgebühr zu erheben; die Eintragung selbst ist grundsätzlich für alle kostenfrei.
Entgegen der ursprünglichen Rechtslage können sich gemeinnützige Vereine seit 2020 von der Gebühr befreien lassen. Zum 1. August 2021 wurde das Verfahren für eine mögliche Gebührenbefreiung für gemeinnützige Verein erheblich vereinfacht. Statt eines Nachweises der Gemeinnützigkeit durch die Vorlage eines Freistellungsbescheids reicht nun eine formlose Versicherung unter Angabe des zuständigen Finanzamtes und der Steuernummer. Ferner muss das Einverständnis gegeben werden, dass die registerführende Stelle beim zuständigen Finanzamt eine Bestätigung der Verfolgung der steuerbegünstigten Zwecke einholen darf, siehe auch www.transparenzregister.de. Eine rückwirkende Befreiung ist grundsätzlich nicht möglich.
Bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) findest du anhand folgender Links ausführliche Hintergründe und Informationen über die Möglichkeiten zur Gebührenbefreiungen für gemeinnützige Organisationen:
www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/aktuelles/transparenzregister
Transparenzregister: Neue Regelungen in Kraft - Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt